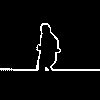Coffee is health food: Myth or fact?
Wie viel Kaffee ist okay?
„Auch wenn Kaffee vielen Menschen gut tut, medizinisch und pharmakologisch ist Koffein eine Droge“, sagt Hartmut Göbel, Facharzt für Neurologie an der Schmerzklinik Kiel – wenn auch eine sozialverträgliche.
Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, kurz EFSA, hat 2015 eine Risikobewertung für Koffein durchgeführt. Das Resultat: Eine Einzeldosis von 3 mg pro Kilogramm Körpergewicht sei unbedenklich. Das bedeutet, dass eine Frau mit einem Gewicht von 60 Kilo 180 Milligramm Koffein als Einzeldosis zu sich nehmen könnte. Davon ist eine Tasse Kaffee aber weit entfernt: Sie enthält je nach Stärke zwischen 30 und 100 Milligramm Koffein.
Mehr als 400mg Koffein sollten es laut EFSA aber generell nicht über den Tag verteilt sein. Das entspricht in etwa 4,5 Tassen Kaffee.
Für Kardiologen sind drei bis fünf Tassen am Tag okay. Das verringert das Risiko, Herzkreislauf-Erkrankungen zu bekommen – beispielsweise Durchblutungsstörungen, Schlaganfall oder Herzinfarkt.
Laut des Statistischen Bundesamts wurden im Jahr 2020 im Schnitt 168 Liter Kaffee getrunken – das entspricht einem knappen halben Liter am Tag.
Frauen, die stillen, sollten am Tag laut EFSA maximal 200 mg Koffein zu sich nehmen. Das gilt auch für Schwangere, wichtig hier: Die Koffeinmenge sollte sich auch über den Tag verteilen. Sonst besteht die Gefahr, dass der Fötus schlechter wächst.
Was ist Koffein?
Mehr als 1000 Inhaltsstoffe von Kaffee sind mittlerweile identifiziert. Koffein ist nicht nur der bekannteste, sondern auch der wirksamste. Chemisch gesehen gehört Koffein zu den Alkaloiden – und wird pharmakologisch und medizinisch als Droge eingestuft. Es wirkt stimulierend und ist damit quasi ein legales Aufputschmittel, das die Konzentration und die körperliche Leistung steigern kann.
Schon seit Jahrhunderten trinken Menschen Getränke mit Koffein. Er ist nicht nur ein natürlicher Bestandteil in Kaffee-, sondern auch in Kakaobohnen. Er befindet sich in
Teeblättern, Guarana-Beeren und Kolanüssen. Außerdem wird Koffein zum Teil auch Arzneimitteln, Kosmetikprodukten und Lebensmitteln (zum Beispiel Eis, Süßigkeiten, Getränken) künstlich zugesetzt.
Wie wirkt Koffein?
Etwa 15 bis 30 Minuten dauert es, bis Koffein im Körper wirkt. Von Magen und Dünndarm aus gelangt es ins Blut, verteilt sich im gesamten Körper – und landet auch im Gehirn. Denn Koffein passiert die Blut-Hirn-Schranke. Abgebaut wird der Stoff nach einigen Stunden in der Leber und dann über die Nieren wieder aus dem Körper ausgeschieden.
Und jetzt konkret: Koffein funktioniert als Wachmacher, weil es ein Molekül blockiert, das müde macht – das Adenosin. Weil sich die beiden Moleküle ähneln, kann Koffein im Gehirn die Adenosin-Rezeptoren besetzen. Und so verhindern, dass der Körper Müdigkeitssignale erhält. Dieser Effekt kann ein bis zwei Stunden anhalten.
Gleichzeitig stimuliert Koffein das zentrale Nervensystem. Es sorgt dafür, dass auch die Hormone Adrenalin und Cortisol vermehrt ausgeschüttet werden – Stresshormone, die den Körper zum Beispiel bei Gefahr schützen. Sie aktivieren Schutzmechanismen des Körpers: Verengen die Blutgefäße, lassen den Blutdruck steigen, auch die Sauerstoffversorgung der Zellen verbessert sich. Das gesamte Herzkreislaufsystem wird angeregt.
Die Konsequenz: Der Körper wird wachsamer und leistungsfähiger, wir können uns besser konzentrieren und fühlen uns fitter.
Allerdings entwickelt der Körper bei Menschen, die regelmäßig viel Kaffee trinken, mehr Andockplätze für das Molekül Adenosin – der Effekt, dass Kaffee einen wach macht, schwächt sich dann ab.
Was passiert bei Koffeinentzug?
Koffeinentzug kann typische Entzugserscheinungen hervorrufen. Zwölf bis 24 Stunden nach der letzten Tasse Kaffee reagiert der Körper am stärksten – mit Müdigkeit oder Kopfschmerzen. Die Konzentration fällt schwerer, man hat weniger Energie. Der Grund: Es gibt auf einmal sehr viele freie Rezeptoren für das Adenosin.
Setzt man das Koffein ab, so tritt eine Art Rebound-Effekt auf, die Sauerstoffversorgung der Zellen verschlechtert sich. Nach ein bis zwei Tagen hat sich der Körper vom Kaffeeentzug erholt. Denn Koffein kann zwar abhängig machen, aber längst nicht so stark wie Alkohol, Nikotin oder harte Drogen.
Ab und zu auf Kaffee zu verzichten, kann sinnvoll sein. Denn der Körper reagiert auf die regelmäßige Zufuhr von Koffein und bildet sogar mehr Adenosin-Rezeptoren aus. Heißt: Je mehr Koffein wir regelmäßig zu uns nehmen, desto schlechter wirkt es. Oder andersrum gesagt: Wer seltener Kaffee trinkt, profitiert stärker vom Wachmacher-Effekt als Dauer-Kaffeetrinker:innen.
Was ist in Kaffee?
Nicht alle Inhaltsstoffe sind bis heute entschlüsselt – aber inzwischen sind mehr als 1.000 Inhaltsstoffe bekannt.
Koffein ist zwar der bekannteste, der am besten untersucht ist – aber auch nicht der einzige, der eine Wirkung hat: In Kaffee gibt es beispielsweise auch verschiedene Vitamine, aber auch Mineralstoffe, Kalzium, Kalium, Magnesium und Phosphor.
Warum reagieren wir unterschiedlich auf Kaffee?
Forschende der Northwestern University in Illinois konnten zeigen: Warum Kaffee bei manchen besser wirkt als bei anderen, hängt auch von den Genen ab.
Offenbar trinken demnach vor allem die Menschen mehr Kaffee, die Bitterstoffe im Koffein stärker schmecken als der Durchschnitt. Ein Ergebnis, das erst einmal paradox klingt – und auch die Forschende überrascht hat: „Man würde erwarten, dass Menschen, die besonders empfindlich auf den bitteren Geschmack von Koffein reagieren, weniger Kaffee trinken würden“, sagt Marilyn Cornelis, die an der Studie mitgewirkt hat.
Für Cornelis und ihre Kolleg:innen zeigen die Ergebnisse, dass gerade die Menschen, die Bitterstoffe von Koffein besonders intensiv wahrnehmen, die positiven Eigenschaften von Koffein mehr zu schätzen wissen. Sie haben offenbar gelernt, dass Kaffee gut tut – so wie man zum Beispiel auch ein bitteres Medikament akzeptiert. Denn eigentlich sind Bitterstoffe für den Körper ein Warnsignal.
Quellen
- Göbel, Hartmut (Facharzt für Neurologie an der Schmerzklinik Kiel)
- Smollich, Martin (Institut für Ernährungsmedizin der Uniklinik Lübeck)
- Burke, Tina M: Effects of caffeine on the human circadian clock in vivo and in vitro, Science Translational Medicine, 2015
- Bundesinstitut für Risikobewertung: Fragen und Antworten zu Koffein und koffeinhaltigen Lebensmitteln, einschließlich Energy Drinks, 2015 (PDF)
- Internationale Agentur für Krebsforschung der WHO
- Ehlers, Anke: Koffeinhaltige Lebensmittel aus Sicht der Risikobewertung (Fortbildungspräsentation für den Öffentlichen Gesundheitsdienst des Bundesinstituts für Risikobewertung, April 2016) (PDF)
- Gunter, Marc J et al: Coffee Drinking and Mortality in 10 European Countries: A Multinational Cohort Study, Annals of Internal Medicine, 2017
- Loomis, Dana: Carcinogenicity of drinking coffee, mate, and very hot beverages, The Lancet, 2016
- Islami, Farhad et al.: A prospective study of tea drinking temperature and risk of esophageal squamous cell carcinoma, International Journal of Cancer, 2019
- Ong Jue-Sheng et al.: Understanding the role of bitter taste perception in coffee, tea and alcohol consumption through Mendelian randomization, Nature, 2018
- Rogers, Peter J et al.: Association of the Anxiogenic and Alerting Effects of Caffeine with ADORA2A and ADORA1 Polymorphisms and Habitual Level of Caffeine Consumption, Nature, 2010
- Sigmon, Stacey C et al.: Caffeine withdrawal, acute effects, tolerance, and absence of net beneficial effects of chronic administration: cerebral blood flow velocity, quantitative EEG and subjective effects, Psychopharmacology, 2009
- van Dam, Rob M. et al: Coffee, Caffeine, and Health, The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE , 2020
- EFSA erklärt Risikobewertung: Was ist Koffein? (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, 2015) (PDF)